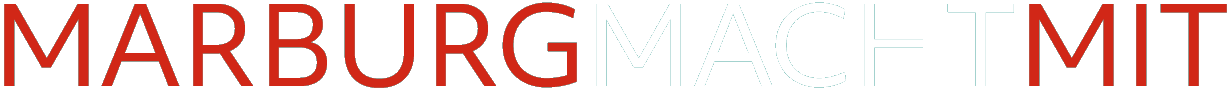Vom 22. August bis zum 30. Oktober 2025 zeigen die Arbeitsgruppe "Menschenbild Behinderter Gestern und Heute" des Marburger Netzwerks für Demokratie und gegen Rechtsextremismus, die Stadt Marburg und das Begegnungshaus KA.RE. die Wanderausstellung „Die nationalsozialistischen ‚Euthanasie‘-Morde“ im KA.RE. in Marburg.
Hier finden Sie die Texte und Bilder der Roll-Ups der Ausstellung als barrierefreies Dokument sowie alle Orte der Karte, die die Opfer der NS-Zwangssterilisation in Hessen zeigt (Gestaltung der Roll-Ups und des barrierefreien Dokuments durch Hasret Sahin). Unter diesem Link finden Sie das Begleitprogramm in Einfacher Sprache.
In der Ausstellung wird aus historischen Gründen der Begriff „Behinderte“ benutzt. Heute sagen wir „Menschen mit Behinderungen“ oder „Menschen mit Einschränkungen“ oder „Menschen mit Beeinträchtigungen“ oder „behinderte Menschen“.
Um was geht es in der Ausstellung? Welche Inhalte mit Bezug zu Marburg dürfen Besucher*innen erwarten? Und welche Möglichkeiten gibt es, die Ausstellung zu erkunden? In unseren FAQ geben wir die wichtigsten Informationen zu der Ausstellung:
Was zeigt die Ausstellung?
Die Wanderausstellung „Die nationalsozialistischen ‚Euthanasie‘-Morde“ dokumentiert die Vorgeschichte, Voraussetzungen und Durchführung der Patient*innenmorde im Nationalsozialismus. Damals wurden Menschen mit psychischen, geistigen und körperlichen Behinderungen systematisch verfolgt und ermordet. Die Ausstellung ist eine Leihgabe des Gedenk- und Informationsortes Tiergartenstraße 4 in Berlin.
Wie ist die Ausstellung aufgebaut?
Die Wanderausstellung beinhaltet zehn Kapitel: von der besonderen Bedeutung der Organisationszentrale in der Berliner Tiergartenstraße 4 bis zu den Erläuterungen weiterer Mordaktionen gegen psychisch kranke sowie geistig und körperlich behinderter Männer, Frauen und Kinder in Deutschland und Europa ab 1939. Sie zeigt die Verbindungslinien der „Euthanasie“-Aktion zur Ermordung der europäischen Jüd*innen auf und beleuchtet das Verdrängen und Verschweigen der Morde nach 1945.
Zehn lebensgeschichtliche Skizzen von Opfern der Patient*innenmorde verbinden die Themenkapitel. Diese verdeutlichen die individuelle Dimension der Verbrechen. Ergänzend wird die Entwicklung des Gedenkens an die „Euthanasie“-Morde in Europa dargestellt.
Themenkapitel:
1. Der Weg in die „Euthanasie“-Morde
2. Krieg nach außen - Krieg nach innen: Patientenmorde 1939-1945
3. Die Familien der Opfer und die Reaktionen in der Gesellschaft
4. „Aussortierung“ in der Heilanstalt
5. Tiergartenstraße 4 - Verwaltungszentrale des Massenmordes
6. Massenmord in den Gaskammern
7. Täter - Mitwisser - Profiteure
8. „Euthanasie“ - Vernichtungskrieg - Holocaust
9. Umgang mit den „Euthanasie“-Verbrechen nach 1945
10. Gedenken in Europa
Lebensgeschichtliche Skizzen:
1. Wilhelm Werner
2. Ilsze Lekschas
3. Irmgard Denker
4. Wilhelmine Haußner
5. Anna Lehnkering
6. Karl Ahrendt
7. Mary Pünjer
8. Grigorij Schamrizkij
9. Fjodor W. Korso
10. Martin Bader
Der von der Arbeitsgruppe "Menschenbild Behinderter Gestern und Heute" erstellte Ausstellungsteil zeigt auf einer topografischen Karte, woher aus Hessen die Opfer der Zwangssterilisation kamen - überdies wie viele und woher aus Marburg. Zudem wird der genaue Ablauf eines Zwangssterilisationsverfahrens erklärt und warum Menschen vor das Erbgesundheitsgericht Marburg kamen. Anhand von Akteneinträgen werden die Schicksale von Opfern aufgezeigt. Darüber hinaus informiert ein Zeitstrahl über Zwangssterilisationen seit Anfang des 20. Jahrhunderts.
Wann und wo findet die Ausstellung statt?
Die Ausstellung ist zu sehen von Freitag, 22. August, bis Donnerstag, 30. Oktober 2025, im großen Saal des Begegnungshauses KA.RE., Biegenstraße 18, in Marburg (1. OG, Fahrstuhl vorhanden). Öffnungszeiten: donnerstags bis sonntags von 16 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wichtiger Hinweis: Vom 2. bis 6. Oktober bleibt die Ausstellung aus organisatorischen Gründen geschlossen.
Zur feierlichen Eröffnung am Freitag, 22. August, um 19 Uhr wird unter anderem Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies sprechen und Sängerin Latoya Reitzner auftreten.
Auf wessen Initiative geht die Ausstellung zurück?
Die Wanderausstellung der Deutschen Forschungsgemeinschaft wird durch die Berliner Stiftung Topographie des Terrors betreut. In Marburg wird die Ausstellung auf Initiative der Arbeitsgruppe „Menschenbild Behinderter Gestern und Heute“ innerhalb des Marburger Netzwerks für Demokratie und gegen Rechtsextremismus und der Stadt Marburg in Kooperation mit dem katholischen Begegnungshaus KA.RE. gezeigt.
Gibt es in der Ausstellung einen Bezug zu Marburg?
Ja. Opfer der Euthanasie waren in Marburg geboren oder hier in Heil- und Pflegeanstalten untergebracht. Wir wissen von mindestens 333 Betroffenen. An sie wird mit der Installation „Steine gegen das Vergessen“ erinnert. Für jedes Opfer wird der Namenszug mit Geburtsdatum und dem Tag der Ermordung in der Tötungsanstalt Hadamar auf einem Backstein angebracht. Zudem wird an die Opfer der NS-Zwangssterilisation erinnert. Das hier ansässige sogenannte „Erbgesundheitsgericht“ hat viele Hundert Menschen aus dem Langgerichtssprengel in Marburger Kliniken zwangssterilisieren lassen.
Wie sieht das Begleitprogramm aus?
Die Begleitveranstaltungen im Überblick:
Montag, 25.08.2025 – 15-17 Uhr
„Politisches Kamingespräch - Haushalte bestimmen Sozialstaatsgebot?!“ (nicht öffentlich)
Fachgespräch der Mitglieder der Paritätischen Kreisgruppe Marburg-Biedenkopf mit den regionalen Vertreter*innen des Hessischen Landtages
Freitag, 05.09.2025 – 17.30 Uhr
Historische Führung durch die Ausstellung mit Dr. Wolfgang Form
Donnerstag, 11.09.2025 – 19-21 Uhr
„Der lange Arm der NS-Verfolgung. Zum Umgang mit den Opfern der Zwangssterilisation nach dem Ende des NS-Regimes“
Vortrag von Dr. Wolfgang Form
Samstag, 13.09.2025 – 10-16 Uhr
Peer-Guide-Training mit Aylin Kortel und Eva-Maria Nitz zur Reflexion von Rolle und Hintergründen sowie zur Vermittlung von Kenntnissen für junge Menschen, die sich bei der Ausstellung als Peer Guides engagieren möchten.
Sonntag, 14.09.2025 – 16 Uhr
Historische Führung durch die Ausstellung mit Dr. Wolfgang Form
Donnerstag, 25.09.2025 – 13-17 Uhr
Forum: "Bedarfsermittlung in der Eingliederungshilfe zwischen Anspruch und Wirklichkeit"
Veranstaltung des NTB e.V.
Montag, 29.09.2025 – 14-16:30 Uhr
„Co-Referent*innen: Behinderung – Wie war es früher und wie ist es heute?“
Veranstaltung des NTB e.V.
Donnerstag, 09.10.2025 – 19 Uhr
"Nebel im August"
Filmvorführung im Capitol Marburg mit anschließender Möglichkeit zum Gespräch
Mittwoch, 15.10.2025 – 19-20 Uhr
Ökumenische Andacht in der Ausstellung
Gottesdienst
Donnerstag, 16.10.2025 – 17:30-19 Uhr
„Videospiele in der Erinnerungskultur: Chancen eines unterschätzten Mediums“
Vortrag von und gemeinsames Spielen mit Philipp Sarter, Stabsstelle Bürger*innenbeteiligung
Samstag, 18.10.2025 – 18-20 Uhr
Lese- und Vortragsveranstaltung mit Gespräch mit Schriftsteller Robert Domes zu seinem Buch "Nebel im August"
Montag, 20.10.2025 – 16:30-18 Uhr
Offene Führung durch die Ausstellung in Einfacher Sprache mit Gertrud Nagel, Anna Long und Tanja Luft
Für Menschen mit Lernschwäche geeignet; keine Anmeldung erforderlich
Mittwoch, 22.10.2025 – 9:30-11 Uhr
Führung durch die Ausstellung in Einfacher Sprache mit Gertrud Nagel, Anna Long und Tanja Luft
Exklusive Führung für Mitarbeitende der Lahnwerkstätten und Hinterländer Werkstätten
Mittwoch, 22.10.2025 – 19-21 Uhr
„Kultur gegen das Vergessen. Der steinige Weg zu einer opferzentrierten Erinnerungskultur in Hessen“
Vortrag von Tobias Karl M.A., Dr. Steffen Dörre, Prof. Sabine Mecking
Donnerstag, 23.10.2025 – 19 Uhr
"Werk ohne Autor"
Filmvorführung im Capitol Marburg mit anschließender Möglichkeit zum Gespräch
Dienstag, 28.10.2025 – 19 Uhr
Finissage zum Ende der Ausstellung
Mittwoch, 29.10.2025 – 19.30-21 Uhr
Perspektiven des Lebens: Wert, Herausforderung und Entscheidung
Podiumsgespräch mit Franziska Fischer, Andrea Hessberger, Christof Ohnesorg und Sebastian Blümel
Monatlich finden spezielle Peer-Rundgänge für Menschen mit Seh- und Hörbeeinträchtigung sowie in Leichter Sprache statt. Einzelheiten und Termine werden noch bekannt gegeben. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten.
____________________________________________________________________________________________________________________________
„Politisches Kamingespräch - Haushalte bestimmen Sozialstaatsgebot?!“
Datum: Montag, 25. August 2025
Uhrzeit: 15-17 Uhr
Ort: nicht öffentlich
Dennoch gilt es, mit den vorhandenen (finanziellen) Ressourcen bedarfs- und teilhabeorientierte Angebote zur Verfügung zu stellen und zwingend geltendes Recht umzusetzen. Unser Sozialstaat befindet sich im Umbruch – wie kann eine nachhaltige Finanzierung sichergestellt werden, trotz demographischer Entwicklung, Lohnkostensteigerungen und Inflation? Wie kann/muss Inklusion und Chancengleichheit umgesetzt werden? Welche innovativen Lösungen gibt es, um Dienstleistungen effizienter und zugänglicher zu machen? Prävention statt Reaktion – frühzeitige Unterstützung vermeidet umfangreichere (teurere) Maßnahmen, … Dies sind nur einige Fragen, die wir uns gerade stellen müssen…
In der Umsetzung des BTHG und den damit verbundenen Einsparungsplänen, aber auch bei den Konsolidierungsplänen in der Stadt Marburg sind wir konfrontiert mit unterschiedlichen Problem- und Fragestellungen: Welches Menschenbild wird vermittelt (z.B. Behinderte als „Kostenfaktor“)? Wird geltendes Recht gebrochen (z.B. BTHG – UN-BRK)? Wird das Subsidiaritätsprinzip eingehalten (z.B. Stadt MR übernimmt zunehmend Aufgaben selbst)? Werden, sogenannte, „freiwillige Leistungen“ gekürzt? Wird ehrlich damit umgegangen, „was (finanziell) geht und was in Zukunft nicht mehr geht“?...
Über all diese Punkte möchten wir gerne untereinander, Mitglieder der Kreisgruppe Marburg-Biedenkopf des Paritätischen Hessen, und mit den Mitgliedern des Landtags in den Austausch kommen. Zugesagt haben:
Marie-Sophie Künkel (CDU), Dirk Bamberger (CDU) und Sebastian Sack (SPD)
_____________________________
„Der lange Arm der NS-Verfolgung. Zum Umgang mit den Opfern der Zwangssterilisation nach dem Ende des NS-Regimes“
Vortrag von Dr. Wolfgang Form
Datum: Donnerstag, 11. September 2025
Uhrzeit: 19-21 Uhr
Ort: KA.RE. Ausstellungsraum
Schon wenige Monate nach dem Ende des NS-Regimes wurde es den Opfern der Zwangssterilisation deutlich vor Augen geführt, dass sie nicht als Nazi-Opfer betrachtet werden. Nur in Ausnahmefällen wurde ihnen staatliche Unterstützung zugebilligt. Denjenigen Opfern, die die Sterilisation rückgängig gemacht haben wollten, wurden administrative Hürden in den Weg gelegt. Schließlich, so die gängige Argumentation, sei alles doch rechtens per Gerichtsbeschluss abgelaufen. Entsprechend wurde dieses NS-Opfergruppe aus den bundesdeutschen Entschädigungsregelungen (Bundesentschädigungsgesetz - BEG) ausgeklammert. Auch Bemühungen, sie in den 1960er-Jahren doch noch unter das BEG fallen zu lassen, scheiterten u.a. an der Intervention der Marburger Psychiater Ehrhardt und Villinger. Erst ab 1980 konnten Opfer Entschädigung beantragen.
_____________________________
Peer-Guide-Training
Datum: Samstag, 13. September 2025
Uhrzeit: 10-16 Uhr
Ort: wird nach Anmeldung bekannt gegeben
Im Rahmen der Ausstellung „Die nationalsozialistischen ‚Euthanasie‘-Morde“ suchen wir junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren, die sich als Peer Guides engagieren möchten. Peer Guides übernehmen eine unterstützende Rolle in der Begleitung von Gruppen durch die Ausstellung – sie fördern den Austausch und erleichtern Lernprozesse.
Zur Vorbereitung bieten wir ein eintägiges Training an, das die künftigen Peer Guides auf ihre Rolle vorbereitet. In dem Workshop wird die Trainerin Aylin Kortel grundlegende Moderationstechniken, Ziele und Grundhaltungen der außerschulischen (historisch-) politischen Bildungsarbeit und Techniken zum Umgang mit schwierigen Situationen vermitteln. Außerdem können die Peer Guides eigene Bezüge zum Nationalsozialismus und ihre Rolle als Peer Guides reflektieren. Eva-Maria Nitz, die als Guide in der Gedenkstätte Hadamar arbeitet, wird inhaltlich in die Geschichte der nationalsozialistischen Patient*innenmorde einführen.
Das Engagement als Peer Guide erfolgt ehrenamtlich und bietet jungen Menschen die Möglichkeit, sich aktiv gegen Diskriminierung und für historisch-politische Bildung einzusetzen.
Anmeldung erforderlich unter:
✉ marburgmachtdemokratie@marburg-stadt.de
_____________________________
Forum „ Bedarfsermittlung in der Eingliederungshilfe zwischen Anspruch und Wirklichkeit"
Datum: Donnerstag, 25. September 2025
Uhrzeit: 13-17 Uhr
Ort: KA.RE. Ausstellungsraum
NTB e.V. mit seiner EUTB® lädt zum Forum Bedarfsermittlung am 25. September 2025 zur kritischen Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Instrumenten der Hilfeplanung ein – insbesondere mit dem hessischen Bedarfsermittlungsinstrument PiT („Personenzentrierte integrierte Teilhabeplanung“).
Wie viel Kontinuität besteht zwischen früheren, defizitorientierten Menschenbildern und heutigen Verfahren der Bedarfsermittlung. Dieser Frage widmet sich die dreiteilige Veranstaltung.
Zum Auftakt bietet Prof. Dr. Albrecht Rohrmann (Universität Siegen) eine wissenschaftliche Einordnung der bundesweiten wie hessischen Praxis der Bedarfsermittlung im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention und ihrer Forderung nach Selbstbestimmung und Teilhabe. Er überschreibt seinen Vortrag mit der Überschrift: „Selbstbestimmung behinderter Menschen und Hilfeplanung im Spannungsverhältnis“.
Im zweiten Teil übernehmen Co-Referent*innen mit Behinderung das Wort. Ausgehend von eigenen Erfahrungen mit dem PiT beleuchten sie, welche Bedeutung das Instrument für sie hat, wie es sich anfühlt, Bedarfserhebung zu erleben, und inwiefern sich tatsächlich ein personenzentrierter Ansatz erkennen lässt. Die Teilnehmenden sind eingeladen, sich aktiv einzubringen und gemeinsam zu reflektieren, welche Rolle Kommunikation im Prozess spielt und wie entwürdigend Bedarfsermittlung bei manchen Themen wirken kann.
Abschließend bringen Peer-Berater*innen der EUTB Marburg-Biedenkopf Perspektiven aus der Beratungspraxis ein – mit Skizzen typischer Fallbeispiele, die sowohl Herausforderungen als auch Potenziale sichtbar machen.
Ein offener Austausch rundet das Forum ab.
____________________„Co-Referent*innen: Behinderung - Wie war es früher und wie ist es heute?“
Datum: Montag, 29. September 2025
Uhrzeit: 14-16:30 Uhr
Ort: KA.RE. Ausstellungsraum
NTB e.V. mit seiner EUTB® hat die Co-Referent*innen eingeladen, Behinderung gestern und heute fassbar zu machen.
Co-Referent*innen sind Menschen mit Behinderung die nach einer speziellen Ausbildung als Referent*innen qualifiziert bei der Ausbildung von Heilerziehungspfleger*innen wirken. Menschen mit Behinderung schaffen aus Ihrer Sicht die Brücke Menschenbild Behinderter gestern und heute.
„Mit unserer Bildungseinheit am 29.09.2025 im Rahmen der T4 Ausstellung möchten wir versuchen einen Bogen zu schlagen.
Wie war es früher – wie ist es heute?
Auf welchem Weg befinden wir uns?
Was ist seit der Entmachtung des NS-Regimes gelungen,
unter dem Menschen mit Behinderung systematisch Verfolgt und ermordet wurden,
gibt es noch Anlass zu handeln, genau hinzuschauen und aufmerksam zu machen?
Wir haben uns damit beschäftigt und waren mit unserem Programm bereits bei mehreren Zielgruppen unterwegs.
Wir freuen uns auf jeden von Ihnen und ein aktives, gemeinsames Lernen."
_____________________________
„Nebel im August“
Filmvorführung im Capitol Marburg mit anschließender Möglichkeit zum Gespräch
Datum: Donnerstag, 09. Oktober 2025
Uhrzeit: 19 Uhr
Ort: Capitol Marburg
„Nebel im August“ ist ein Drama aus dem Jahr 2016 und basiert auf einer wahren Begebenheit. Der Film erzählt die letzten Jahre im kurzen Leben des Halbwaisen Ernst Lossa. Der 13-Jährige wird als "asozial" und "nicht erziehbar" eingestuft und 1940 in eine Nervenheilanstalt abgeschoben. Als er begreift, dass dort körperlich und geistig behinderte sowie psychisch kranke Menschen ermordet werden, versucht er, Leben zu retten. Dabei gerät er selbst auf die Todesliste des Anstaltsleiters.
Der Film wird mit Untertiteln für Gehörlose ausgestrahlt. Personen mit einer Sehbeeinträchtigung können die App "Greta" zur Audiodeskription nutzen. Überdies wird die Filmvorführung und die an den Film anschließende offene Diskussion durch eine*n Gebärdendolmetscher*in begleitet. Der Eintritt ist frei.
_____________________________
Ökumenische Andacht in der Ausstellung
Gottesdienst
Datum: Mittwoch, 15. Oktober 2025
Uhrzeit: 19-20 Uhr
Ort: KA.RE. Marburg, Biegenstraße 18
Die Klinik-Seelsorgenden Dorothee Urhahn-Diel und Sebastian Blümel laden in der Ausstellung und im Angesicht der Installation „Steine des Gedenkens“ zu einer ökumenischen Andacht ein. Die Teilnehmenden erwarten Impulse und geistliche Elemente zur Ausstellungsthematik.
_____________________________
„Videospiele in der Erinnerungskultur: Chancen eines unterschätzten Mediums“
Vortrag von und gemeinsames Spielen mit Philipp Sarter, Stabsstelle Bürger*innenbeteiligung
Datum: Donnerstag, 16. Oktober 2025
Uhrzeit: 17:30-19 Uhr
Ort: KA.RE. Ausstellungsraum
Videospiele erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und sind längst keine Nischenhobbys mehr. Während Bücher, Filme und Serien einen festen Platz im Umgang mit sensiblen Themen haben, wird dem Medium „Videospiel“ häufig noch zu wenig Potenzial eingeräumt. Dabei bieten Spiele ein hohes Vermittlungspotenzial und erreichen als interaktive Form auch Zielgruppen, die sich mit „klassischen“ Formaten nicht angesprochen fühlen. In der Veranstaltung werden Möglichkeiten von Spielen in der Gedenkarbeit und für die Erinnerungskultur gezeigt, sowie die Arbeit der „Stiftung digitale Spielekultur“ in den Themenbereichen „Erinnern mit Games“ und „Let’s Remember! Erinnerungskultur mit Games vor Ort“ vorgestellt. Es werden beispielhaft einige Spiele präsentiert und anschließend in Kleingruppen das Spiel „Spuren auf Papier“ der Gedenkstätte Wehnen gespielt.
Bringen Sie hierfür gerne ein Tablet mit, WLAN ist im Ausstellungsraum vorhanden.
_____________________________
„Nebel im August - Die Lebensgeschichte des Ernst Lossa“
Buchvorstellung und Gespräch mit dem Autor und Journalisten Robert Domes zu seinem Buch
Datum: Samstag, 18. Oktober 2025
Uhrzeit: 18 Uhr
Ort: KA.RE Marburg, Biegenstraße 18
Robert Domes hat für sein Buch fünf Jahre recherchiert. Er erzählt die Geschichte von Ernst Lossa. Mit zwölf Jahren wird Ernst - weder behindert noch geisteskrank - zwangsweise in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen, weil seine Eltern Jenische (Schimpfwort: "Zigeuner") sind. 1944 wird Ernst Lossa - wie auch viele andere Kinder - in der Anstalt in Kaufbeuren ermordet.
Das Buch diente als Vorlage für den gleichnamigen Film, der am Donnerstag, 9. Oktober 2025, um 19 Uhr im Capitol gezeigt wird (siehe oben). Buch und Film sind mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden.
_____________________________
„Kultur gegen das Vergessen. Der steinige Weg zu einer opferzentrierten Erinnerungskultur in Hessen“
Vortrag von Tobias Karl M.A., Dr. Steffen Dörre, Prof. Sabine Mecking
Datum: Mittwoch, 22. Oktober 2025
Uhrzeit: 19-21 Uhr
Ort: KA.RE. Ausstellungsraum
Im Rahmen der Ausstellung über die nationalsozialistischen „Euthanasie“-Morde laden wir herzlich zu einem Abendvortrag mit anschließender Diskussion ein.
Das Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen „Euthanasie“-Verbrechen ist von auffälligen Brüchen geprägt. In Hessen wechselten sich über Jahrzehnte Phasen des Schweigens und geringen gesellschaftlichen Interesses mit Phasen intensiverer Auseinandersetzung ab. Warum blieb eine nachhaltig und kontinuierlich gewachsene Gedenkkultur über Jahrzehnte aus, obwohl es bereits in der frühen Nachkriegszeit erste Ansätze des Gedenkens gab?
Der Vortrag geht dieser Frage nach und nimmt die erinnerungskulturellen Entwicklungen ab 1945 in Hessen in den Blick. Dabei wird die lange Marginalisierung der Betroffenen in den Fokus gerückt und aufgezeigt, wie sich das Gedenken an die Leidtragenden der nationalsozialistischen Psychiatriepolitik gewandelt hat.
Darüber hinaus werden die Referent:innen die Rolle Marburgs in der NS-„Euthanasie“ beleuchten und zentrale Erkenntnisse aus ihrer aktuellen Veröffentlichung „‚Zwischenanstalten‘ im Nationalsozialismus Dynamiken von Vernachlässigung und Vernichtung“ zu lokalen und überregionalen Aspekten der NS-Verbrechen vorstellen.
Im Anschluss an den ca. 45-minütigen Vortrag besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch - gerne auch noch im Anschluss informell im Ausstellungsraum. Eine offene Gesprächsatmosphäre soll dazu einladen, eigene Fragen und Perspektiven einzubringen.
Tobias Karl M.A. ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Philipps-Universität Marburg und forscht und lehrt zur Landes- und Zeitgeschichte.
Dr. Steffen Dörre ist Historiker mit einem Forschungsschwerpunkt in der Geschichte von Psychiatrie und Psychotherapie im 20. Jahrhundert.
Prof. Dr. Sabine Mecking ist Professorin an der Philipps-Universität Marburg und forscht und lehrt zur Landes- und Zeitgeschichte.
_____________________________
„Werk ohne Autor“
Filmvorführung im Capitol Marburg mit anschließender Möglichkeit zum Gespräch
Datum: Donnerstag, 23. Oktober 2025
Uhrzeit: 19 Uhr
Ort: Capitol Marburg
Deutschland in den 1960er Jahren: Dem jungen Künstler Kurt Barnert gelingt die Flucht aus der DDR nach Westdeutschland. Aber auch dort wird er von den Kindheits- und Jugenderinnerungen an seine traumatischen Erlebnisse während der NS-Zeit und unter dem SED-Regime verfolgt. In der Kunststudentin Elisabeth 'Ellie' Seeband findet Barnert schließlich die große Liebe, die auch zu seiner Muse wird. Ellie setzt kreative Energien in ihm frei, aus denen wiederum stilistisch einzigartige Bilder entstehen. In ihnen arbeitet Barnert seine eigene Vergangenheit auf und reflektiert zugleich die historischen Traumata eines ganzen Volkes.
Der Film wird mit Untertiteln für Gehörlose ausgestrahlt. Personen mit einer Sehbeeinträchtigung können die App "Greta" zur Audiodeskription nutzen. Überdies wird die Filmvorführung und die an den Film anschließende offene Diskussion durch eine*n Gebärdendolmetscher*in begleitet. Der Eintritt ist frei.
_____________________________
Finissage
Datum: Dienstag, 28. Oktober 2025
Uhrzeit: 19 Uhr
Ort: KA.RE. Ausstellungsraum
Genauere Informationen folgen.
_____________________________
Perspektiven des Lebens: Wert, Herausforderung und Entscheidung
Podiumsgespräch
Datum: Mittwoch, 29. Oktober 2025
Uhrzeit: 19:30-21 Uhr
Ort: KA.RE. Marburg, Biegenstraße 18
Anlässlich der historischen Ausstellung zu den nationalsozialistischen "Euthanasie"-Morden und Zwangssterilisationen soll auf gegenwärtige Perspektiven des Lebens mit und ohne Behinderung geschaut werden, wobei ein Fokus auf dem Lebensbeginn liegt. Es geht dabei ausdrücklich nicht um die kontroverse Diskussion extremer Positionen, sondern um den Austausch und das Zusammenlegen unterschiedlicher Erfahrungen und Blickwinkel. Die Gastgebenden von KA.RE. connect begrüßen zum Gespräch: die Marburger Gynäkologin Franziska Fischer, Andrea Hessberger von der Beratungsstelle neu:haus Marburg sowie Christof Ohnesorge, Vater eines Kindes mit Down-Syndrom und Sebastian Blümel, Klinikpfarrer am Marburger Universitätsklinikum. Wir freuen uns auf einen fruchtbaren Austausch zu einem komplexen und sensiblen Thema.
Wie wird auf Barrierefreiheit geachtet?
Die Wanderausstellung bietet eine mobile und barrierearme Präsentation der Inhalte. So sind die Texte der Roll-Ups der T4-Ausstellung auf Deutsch und in Leichter Sprache verfasst, überdies gibt es zwei Medienstationen mit Zusammenfassungen der Ausstellungstexte in deutscher Gebärdensprache und als Audios für Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Außerdem gibt es in der Ausstellung Braille-Beschriftungen, Hörgerätetransponder und Kopfhörer. Die Texte der Roll-Ups zum Marburg-Teil der Ausstellung sind in Deutsch und in Einfacher Sprache verfasst. Weitere Bedarfe aufgrund von Behinderungen können angemeldet werden.
Inhaltliche Zusammenfassungen der Ausstellungstexte in deutscher Gebärdensprache und als Audios für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen an den Medienstationen:
1. Der Weg in die „Euthanasie“-Morde
2. Bürokratie des Todes
3. Täter – Mitwisser – Profiteure
4. Opfer
5. Entwicklung nach 1945
6. Geschichte des Ortes
Zusätzliche Inhalte und Erläuterungen (nicht barrierefrei):
7. Geschichte des Ortes – Bilder und Dokumente
8. Der „T4“-Meldebogen
9. Die Orte der „Euthanasie“-Morde
Auch bei der Auswahl des Ausstellungssaals wurde auf Barrierefreiheit geachtet. Der Zugang zur Ausstellung im KA.RE. wird so gestaltet, dass er etwa auch für Rollstuhlfahrer*innen erreichbar ist.
Werden Führungen durch die Ausstellung angeboten?
Ja. Um gerade junge Menschen anzusprechen, wurde ein Konzept für einen Peer-Rundgang entwickelt: Gruppen erschließen sich die Ausstellung selbst und stellen sich ihre Eindrücke im Anschluss gegenseitig vor. Die Peer-Rundgänge werden von Peer Guides begleitet. Ein Peer Guide ist eine Person, die innerhalb einer Gruppe eine unterstützende Rolle übernimmt und einen Lernprozess erleichtert. Die Guides werden vorab geschult und bei der Begleitung von Gruppen eingesetzt. Hierfür werden noch junge Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren gesucht. Wer Interesse hat, oder einen Ausstellungsrundgang buchen möchte, kann sich melden unter: marburgmachtdemokratie@marburg-stadt.de.
Bitte teilen Sie uns mit:
die Anzahl der teilnehmenden Personen,
um welche Art von Gruppe es sich handelt (z. B. Schulklasse, Menschen mit Sehbeeinträchtigung etc.),
sowie gerne einen bevorzugten Zeitraum für die Führung.
Wie kann ich die Ausstellung unterstützen?
Wer einen Beitrag zur Unterstützung der Ausstellung leisten möchte, kann dies auf ganz vielfältige Weise tun.
Organisationen, Unternehmen, Vereine o.Ä. können sich als Projektpartner an der Ausstellung beteiligen. Sie können …
· den Besuch der Wanderausstellung bei Ihren Kund*innen, Mitarbeiter*innen oder Mitgliedern bewerben.
· einen Ausstellungsbesuch von interessierten Mitarbeiter*innen oder Mitgliedern organisieren, der durch eine sachkundige Führung begleitet wird.
· sich bei der Erstellung von Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, etc.) beteiligen.
· Veranstaltungen im Rahmenprogramm der Ausstellung finanziell unterstützen.
Auch Schulen können sich bei der Ausstellung einbringen. Sie können …
· unter ihren Schüler*innen für eine Einbindung in die Ausstellung als Peer Guide werben.
· unter ihren Schüler*innen für eine weitere Form der aktiven Mitarbeit werben: So können sich Schüler*innen etwa bei der Beaufsichtigung der Ausstellung einbringen.
· die Ausstellung durch einen Besuch von Schulklassen in den Unterricht integrieren, etwa im Rahmen von Projekttagen/ Projektwochen.
· die Wanderausstellung im Kollegium bewerben.
Die Arbeitsgruppe „Menschenbild Behinderter Gestern und Heute“ des Marburger Netzwerks für Demokratie und gegen Rechtsextremismus, die Universitätsstadt Marburg und das KA.RE. bedanken sich bei den Sponsor*innen für die Unterstützung dieser Ausstellung:
Geschichtswerkstatt Marburg e.V.
Kulturelle Aktion Marburg - Strömungen e.V.
Lebenshilfewerk Marburg-Biedenkopf e.V.
Lebenshilfe Ortsverein Marburg e.V.
Lebenshilfe Ortsverein Biedenkopf e.V.
An wen kann ich mich bei Fragen wenden?
Ansprechperson für Fragen rund um die Ausstellung ist Marcello Di Cicco, Stabsstelle Bürger*innenbeteiligung der Stadt Marburg, Telefon 06421/ 201-7210, E-Mail marcello.dicicco@marburg-stadt.de .